Ganz in blau. Eine vielleicht zu liebevolle Besprechung
Von Hanno Rehlinger
Bleu ist zuallererst rührend. Der Film beginnt mit dem Blick eines Kindes aus dem Rückfenster eines Autos. Die Lichter im Tunnel verschwimmen, sausen davon und große Augen schauen staunend hinterher. Es ist der Blick eines kleinen Mädchens, das auf der Rückbank sitzt und versucht über den Kofferraum zu gucken. Sie hält die blaue Folie eines Lollis aus dem Fenster und lässt sie spielerisch im Wind knistern. Vorne sitzt ihre Mutter und ihr Vater erzählt einen Witz, während das Auto über die verregnete Landstraße braust. Die Kamera schwenkt zu einem jungen Tramper, der am Straßenrand sitzt und mit einem Jojo spielt. Plötzlich hören wir einen Knall.
Der erste Film aus Krzysztof Kieślowskis Serie „Drei Farben“ erzählt die Geschichte von Julie. Die junge Witwe eines berühmten Komponisten, für den sie die Musik geschrieben hat, versucht mit dem Tod ihrer Familie umzugehen. Sie zieht nach Paris, in das Studierendenviertel, in dem sich Bars nur mit Buchläden und Restaurants abwechseln – und natürlich Kinos.
Das Setting ist der 90er-Jahre-Studi-Kitsch in seiner vollendeten Form: Große Bildbände, Wollsocken und elegante Mäntel, gepaart mit lichtdurchfluteter Altbauwohnung, Regen und wahllos zusammengewürfelten Kaffeetassen. In diesem Setting erzählt Kieślowski die Geschichte einer Frau, die sich von der Welt abkapseln möchte, weil sie nicht mehr weiß, wie sie mit ihr umgehen soll. Durch die wunderbare Kameraführung und die wirklich tolle Schauspielerin Juliette Binoche, wird der Zuschauer in diese Geschichte hineingezogen.
So ist schon die erste Szene nach dem Unfall allein durch Julies Blick gedreht. Eine Fluse bewegt sich in dem regelmäßigen Rhythmus ihres Atems auf dem Laken eines Krankenhausbettes. Im verschwommenen Hintergrund erscheint ein Arzt und in der Spiegelung ihres Auges erklärt er ihr was geschehen ist. In der nächsten Szene schaut sie sich unter der Decke auf einem Mini-Fernseher die Beerdigung ihres Mannes an.
Es gibt Filmmaterial, dass Kieślowski beim Drehen zeigt. Die vielen Nahaufnahme erlauben ihm ganz dicht hinter Kameramann und SchauspielerInnen zu stehen und jede Bewegung haargenau zu dirigieren. Es ist ein Bild vollkommener Konzentration: Eine leichte Berührung am linken Arm, oder ein Stupser von der rechten Seite, jede Bewegung ist gewollt, auch die Zufälligen. So geht eine Szene wie folgt:
Julie sitzt in einem Café an der Rue Mouffetard und hört einem Straßenmusiker zu, der gerade genau jene Melodie spielt, die sie im Auftrag der europäischen Kommission vor dem Unfall komponiert hatte. Es sollte eine europäische Hymne werden. Der alte Mann mit der Flöte ist zufällig auf dieselbe Musik gekommen.
In diesem stillen Zuhören tritt Olivier ein. Ein Freund von Julie, der in sie verliebt ist. Ihm wurde der Auftrag der Kommission übertragen, das begonnene Stück zu Ende zu schreiben. Sie hört ihm zu und blickt dabei auf ihren Kaffee. Ein bisschen ist übergeschwappt und auf dem Untersetzer gelandet. Sie nimmt einen Zuckerwürfel und hält ihn, nur mit der Spitze, in die braune Brühe. Fünf Sekunden, bis er sich ganz von unten bis oben vollgesogen hat. Dann lässt sie ihn reinplumpsen.
Kieślowski erzählt, dass seine Assistentin einen ganzen Tag lang Zuckerwürfel ausprobieren musste, weil sie entschieden hatten, dass der Würfel sich in exakt 5 Sekunden vollsaugen sollte – nicht länger, nicht kürzer. Viele Szenen sind auf diese Art aus Julies Perspektive gedreht. Julie spielt mit dem Würfel, um den Mann abzuweisen, der sie liebt, um ihn zu vergessen und die Musik und alles, was sie an das verlorengegangene Leben erinnert.
Bei diesen Szenen bleibt der unermessliche Schmerz im Hintergrund, oder besser noch: im Untergrund. Zurückgekehrt aus dem Krankenhaus veranlasst Julie, dass das ganze Haus, samt Kinderzimmer ausgeräumt und verkauft werden soll. Als sie das erste Mal in das leere Haus tritt, fällt ihre Haushälterin ihr in die Arme und weint. Und auf die Frage, warum sie weine, antwortet die alte Köchin nur: „Weil Sie es nicht tun“.
Dabei ist die Hauptperson weder gefühlskalt noch neurotisch. Sie hat im Gegenteil ein großes Herz und ist ein durch und durch anständiger Mensch. Sie weiß einfach nicht, wie sie mit ihrem Leben umgehen soll und tut es auf die einzige Weise, die ihr möglich ist. Dabei wird keines der Gefühle je angesprochen. Es gibt keine langen Dialoge über Schuld oder Vergessen. Stattdessen findet Julie eine Mäusemutter in ihrer Abstellkammer, umringt von ihrem frischen Wurf. In dieser Nacht kann sie nicht schlafen und am nächsten Tag leiht sie sich die Katze des Nachbarn aus. Aber nachdem sie die Katze in die Wohnung gelassen hat, traut sie sich nicht mehr nach Hause. Sie ruft ihre Nachbarin an und die macht, ohne sie mit Fragen zu quälen, für sie sauber.
Die letzte Szene ist eine Liebesszene. Sie schläft mit Olivier, die fertige Hymne spielt – an Stelle der Chöre hat sie eine Flöte gesetzt – und sie presst ihre Wange an das Glas eines Fensters. Die Kamera blickt aus dem Hinterhof und entfernt sich langsam von der Scheibe, um zu den anderen Menschen zu schweben, die Julies Leben berührt haben – der Junge, der der erste an der Unfallstelle war, die schwangere Liebhaberin ihres Mannes, ihre junge Nachbarin und ihre von Alzheimer geplagte Mutter, die noch immer nicht erinnert und den Turmspringern im Fernsehen zuschaut.
Das Kulturphänomen Slavoj Žižek beschreibt diese Szene als Symbol dafür, dass Julie ihre Distanz zum Leben wiedergefunden hat. Dass sie, nicht zuletzt durch die Musik, wieder diesen Abstand herstellen konnte, der uns das Leben erst erträglich macht. Vielleicht hat er Recht, vielleicht drückt sie die Wange auch nur gegen die Glasscheibe, weil es so ein warmes Bild ergibt. Aber weinen und lachen könnte man bei diesem Anblick und von Distanz kann in Kieslowskis Filmen eigentlich keine Rede sein, denn zu guter Letzt sind sie fast immer und vor allen Dingen rührend.
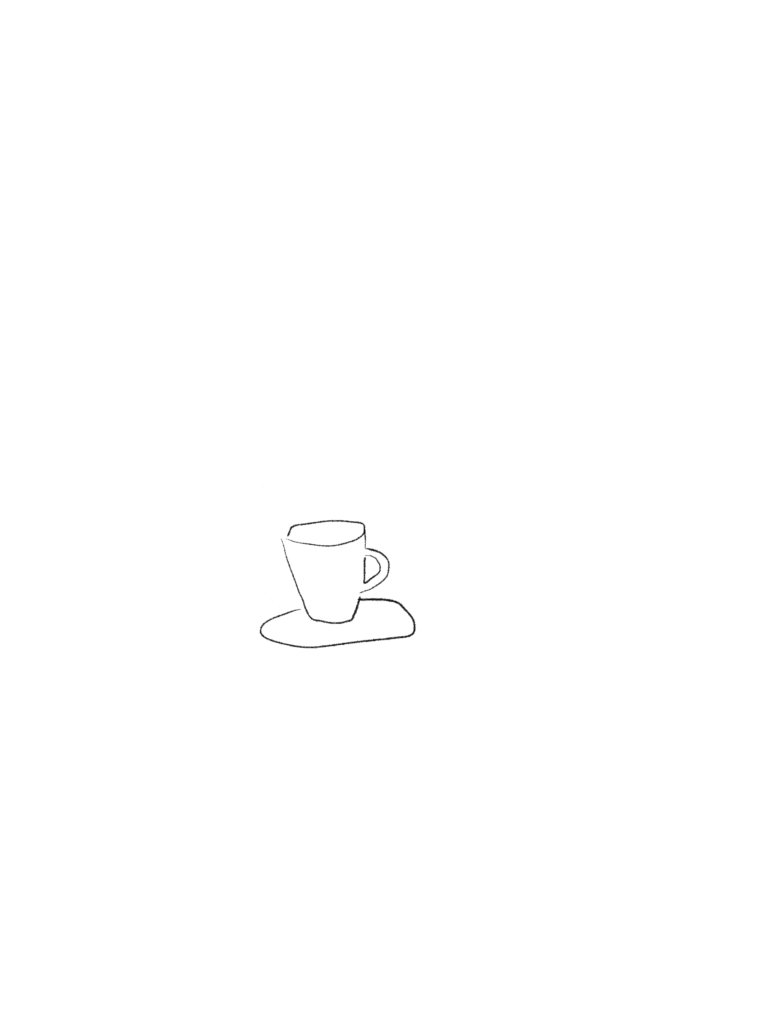
- Holt den Vorschlaghammer! - 31. Mai 2021
- Prof. Germelmann, Sie gestatten? - 26. April 2021
- Sprechen wir Rassismus an! - 27. Februar 2021